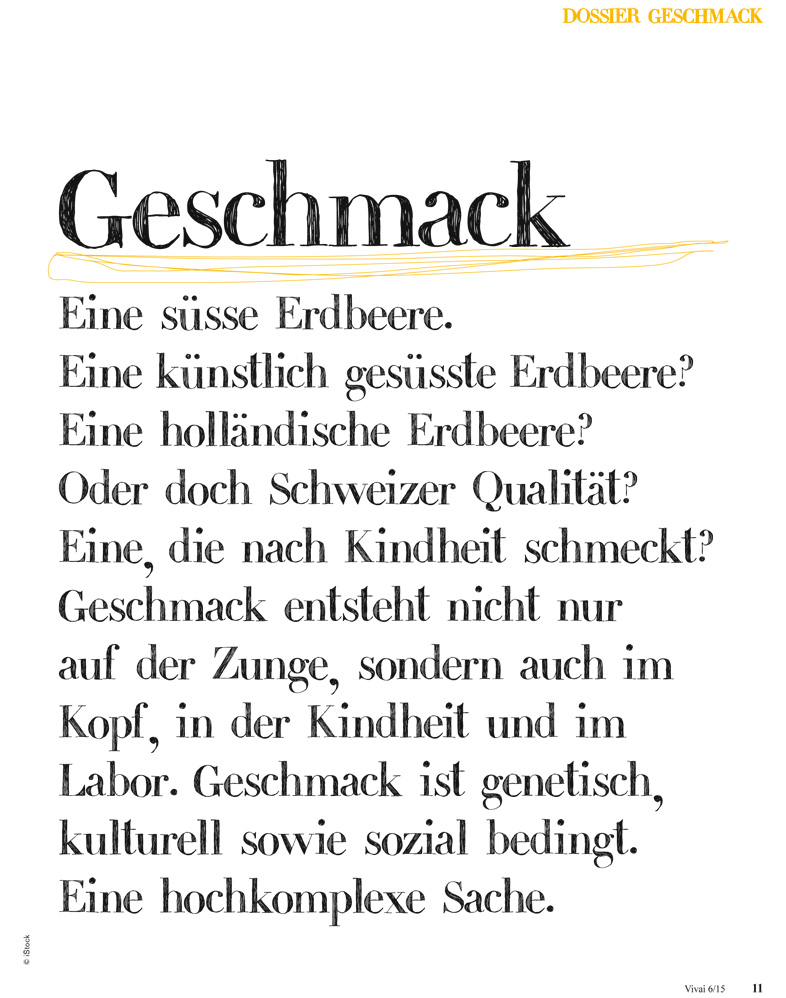30.11.2015, Vivai
Schmeckt wie beim Grosi
Geschmack stiftet Identität und gilt neuerdings als Statussymbol. Schulen oder verfeinern kann man den Geschmackssinn allerdings nicht.
Von Stephanie Rebonati
Der Aufmarsch der Worte fand in einem Szenelokal statt, wie man es in vielen Städten kennt: Die Menükarte handgeschrieben, restaurierte Holzstühle und blassblaue Servietten. Der Kellner öffnete den Mund, und da purzelten sie heraus: «Ein Hauch Thymian, ein Klacks Mascarpone-Sauerrahm, eine Prise Fleur de Sel, ein Kitzeln auf der Zunge, ein warmes Gefühl im Rachen, herbsüss, würzig, aber nicht penetrant, ein krasses Feeling, ein Flair Nordnorwegen, ein Kick Indochina, alles hausgemacht.»
Ein Blick in die Karte verriet, dass er über den bunten Marktsalat an Hausdressing sprach, über den Hackbraten auf Lauchstampf, über die Kürbiswürfel im Blätterteig. Er sprach über Essen und strahlte in die Runde. Den Gästen lief nicht das Wasser im Munde zusammen, vielmehr blieben ihnen die vielen, zu vielen Begriffe im Hals stecken.
Die Demonstration des geschulten Geschmacks gehört heute offenbar zum guten Ton. Essen ist nicht mehr bloss Nahrungsaufnahme, sondern Ereignis und Profilierung. Die Zelebration der Geschmacksverfeinerung soll zeigen: Ich verstehe was davon! Der Geschmack wird im European Food Trends Report des Gottlieb Duttweiler Instituts GDI als neues Statussymbol ausgerufen.
Man isst nicht mehr, sondern spricht leidenschaftlich darüber. Ein Stück Fleisch schmeckt nicht einfach gut, sondern riecht wie ein Spaziergang durch eine Waldlichtung, weckt Sehnsucht, macht wild, richtet in der Mundhöhle eine Geschmacksexplosion und das totale Gefühlschaos aus. Und dies, obwohl unser Gaumen gerade einmal fünf Geschmäcke identifizieren kann: süss, sauer, salzig, bitter und umami (japanisch für Wohlgeschmack, entspricht dem Natriumglutamat).
Der Geschmackssinn ist ein hochkomplexes System, das genetisch, kulturell und sozial bedingt ist. Er ist eng verbunden mit dem Geruchs- und dem Tastsinn sowie mit der Temperatur- und der Schmerzempfindung. Er ist ein sogenannter Nahsinn, der sich nur bei unmittelbarem Körperkontakt erfahrbar macht. Auf saure und bittere Geschmäcke reagiert er sofort, weil sie den Menschen schon seit jeher vor unreifen, verdorbenen oder giftigen Nahrungsmitteln warnen.
Das Gegenteil ist bei süss und salzig der Fall, da sie den Körper auf ernährungswichtige Stoffe wie Kohlenhydrate, Eiweisse und Fette hinweisen. Anders als von vielen Menschen angenommen, ist scharf keine Geschmacksrichtung, sondern ein Schmerz auf der Zunge, auf den der Körper als Gegenreaktion das lindernde Hormon Endorphin ausschüttet. In diesem Zusammenhang wird auch vom Pepper-High gesprochen, einem würzigpikanten Rausch quasi.
Für die Wahrnehmung der fünf wissenschaftlich nachgewiesenen Geschmacksrichtungen süss, salzig, sauer, bitter und umami sind Geschmacksknospen auf der Zunge verantwortlich, die sich beim Fötus bereits im zweiten Schwangerschaftsmonat bilden. Über das Fruchtwasser trägt die Mutter also schon vor der Geburt zur Geschmacksprägung des Kindes bei. Später sind es die Sozialisation, die Rezepte der eigenen Familie, die jeweilige Esskultur mit ihrer Regional- und Nationalküche, die unser Geschmacksempfinden lehren, was lecker ist und wie Identität schmeckt.
Deshalb wird man unweigerlich nostalgisch, wenn man an einer Bäckerei vorbeigeht und den Geruch von frischem Zopf einatmet – sofort sind die Bilder vom Dorf oder von der Strasse, in der man gross wurde, wieder da. Und viele können die Hörnli mit Ghacktem und Apfelmus schmecken, selbst wenn sie nur auf der Karte stehen. Auf der Zunge liegt dann das Gefühl vom vertrauten Zuhause. Es kommt also nicht von ungefähr, dass ein «Es schmeckt wie bei Grossmutter» das grösste Kompliment ist, das der Restaurantkritiker zu verteilen hat.
Die schlechte Nachricht für all jene, die gern mit ihrem gesammelten Geschmackswortschatz beim Essen prahlen: der Geschmackssinn lässt sich als solcher nicht schulen und verfeinern. «Wie in- tensiv man süss, sauer, salzig, bitter oder umami schmeckt, ist eher eine genetische Frage», sagt Patrick Bürgisser, Lebensmittelingenieur und Leiter des Sensoriklabors an der Berner Fachhochschule.
Die Sensorik-Theorie unterscheidet zwischen Super-, Medium- und Non-Tastern. Dem Super-Taster schmeckt etwa eine Cola viel zu intensiv, er wählt seine Lebensmittel sehr sorgfältig aus. Medium-Taster machen zwischen fünfzig und sechzig Prozent der Gesellschaft aus, und die Non-Taster konsumieren eher fettige Speisen und starke Alkoholika. «Es sind vor allem Männer, Europäer und Nordamerikaner, die Non-Taster sind. Frauen sind vielmehr Medium- bis Super-Taster, was sich evolutionär erklären lässt, weil sie vermutlich schon früh für die Lebensmittelzubereitung zuständig waren», sagt Bürgisser.
Der Fachmann erklärt, dass sich zwar der Geschmackssinn nicht verändern lässt, das ganze Geschmackssystem allerdings schon. Die gustatorische Wahrnehmung kann durch intensives Training verfeinert werden, indem man sich immer wieder Reizen aussetzt und so das Erinnerungsvermögen stärkt. Spricht einer nämlich von Holunder und schwarzen Beeren, die er in einem Schluck Rotwein zu erkennen meint, sind das im rein sensorischen Sinn keine Geschmäcke, sondern sogenannte Flavours. Diese wahrzunehmen, kann man über das Zusammenspiel von Geruchs- und Geschmackssinn trainieren.
Müsste Bürgisser den wichtigsten Sinn neben dem Sehen nennen, würde er ohnehin auf seine Nase tippen. Er sagt: «Der Geruchssinn macht den Geschmackssinn erst aus, denn er ist der einzige, der mit dem limbischen System im Gehirn verbunden ist. Dort, wo Emotionen verarbeitet werden.»
Zurück in unser Szenerestaurant, wo der Kellner ein weiteres kulinarisches Gefühlsorchester auszulösen versucht. Mittlerweile sind wir beim Dessert: «Es schmeckt süss-säuerlich, ist cremig, die Kälte wird durch eine Nuance Italianità wettgemacht, übrigens frisch gezupft in unserem Garten, dann ein knusprig-süsses Element als wunderbaren Kontrast zum sämig-weichen, alles hausgemacht!» Was machte er den Gästen schmackhaft? Die Auflösung findet, wer das Heft auf den Kopf stellt. En Guete!
«Geschmack hat mit Identität zu tun»
Petra Hagen Hodgson, Dozentin für Soziologie und Kulturgeschichte des Essens an der ZHAW in Wädenswil.
Frau Hodgson, weshalb wird so viel über Geschmack gesprochen?
Die Menschen sind auf der Suche nach Ursprünglichem und Authentischem. Man möchte wieder mehr Bodenhaftung. Man interessiert sich für alte Tomatensorten, für Bewegungen wie Slow Food oder betreibt Urban Gardening.
Hat Geschmack auch eine soziale Bedeutung?
Erst wenn der Mensch genug zu essen hat, wird Geschmack wichtig. Über
den Geschmack kann man sich von einer anderen Gruppe unterscheiden. Geschmack ist ein Urteilsvermögen, das man von klein auf lernt.
Wie wichtig ist die Küche der Kindheit?
Entscheidend! Durch sie machen wir unsere ersten Geschmackserfahrungen, unser kulturelles Geschmacksgedächtnis wird gelegt. Daher ist es wichtig, dass zu Hause nicht nur globalisiertes Fast Food gegessen, sondern auch gekocht wird. Das hat mit Identität zu tun.
Sie unterrichten Kulturgeschichte des Essens – worum geht es genau?
Wir schauen, was und wie Menschen früher gegessen haben und wie sich das verändert hat. Speisen im Mittelalter etwa hatten einen essigsauren Geschmack, später basierten sie auf Butter. Oder: Die mediterrane Küche ist vegetarischer als die deutsche. Das hat mit kulturellen Entwicklungen zu tun.
Sie haben ein Buch über das Kochen und das Bauen geschrieben. Was
ist den beiden Disziplinen gemein?
Sie decken unsere Urbedürfnisse. Man fügt zusammen, misst und formt, komponiert mit Materialien, mit Farben. Das hat auch mit Genuss zu tun. Geniessen und Geschmack gehören etymologisch betrachtet zusammen – schon immer.